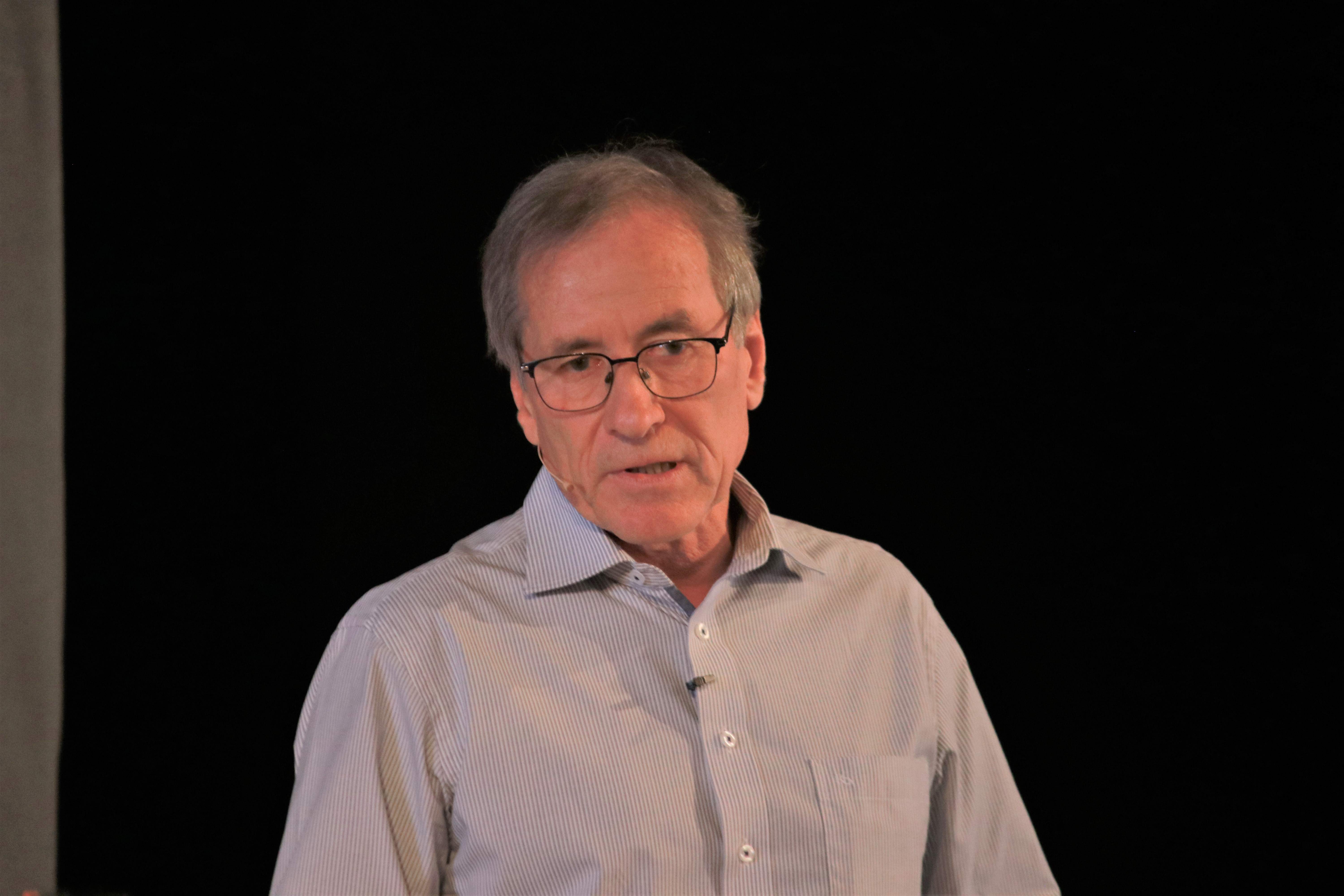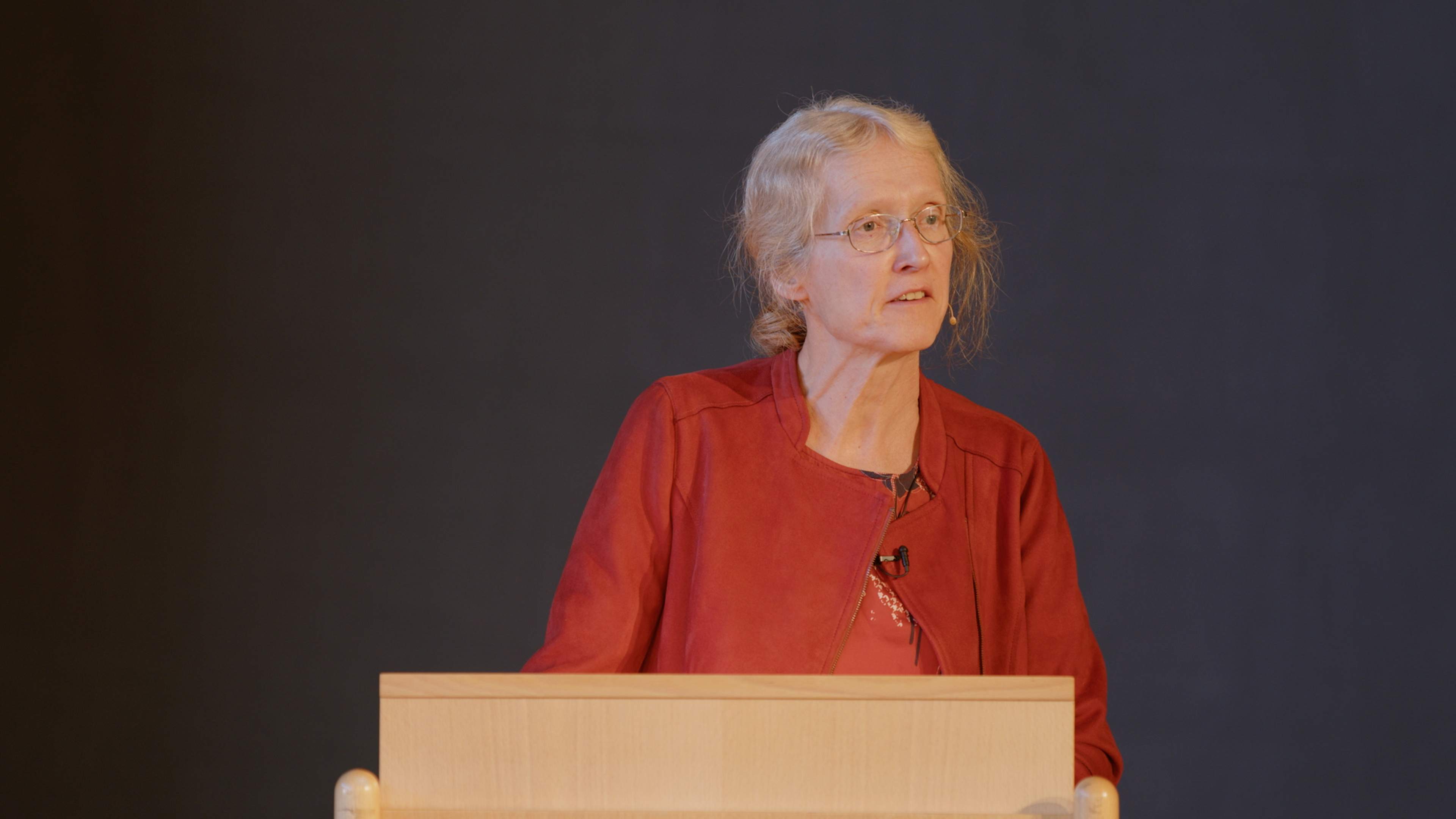Vergangene Tagungen
Tagung am 16. März 2024
Schöpfung und Vollendung
Schöpfung und Vollendung
Zu den Vorträgen als Videoaufnahme und teilweise schriftlicher Version:
Ein gesellschaftliches Minenfeld
Umstrittene Themen standen im Fokus wie «Schöpfungslehre und Evolutionstheorie», «Kirche und Klimawandel».
Wie immer wurde die Tagung mit einem Gottesdienst begonnen. In seiner Predigt äusserte Pfarrer Dr. Christian Stettler sein Befremden, dass für viele Christen die Liebe zur Schöpfung und die Liebe zu Jesus eine Spannung darstelle. Doch das Zeugnis der Schrift sei klar: «Jesus ist nach Johannes 1 das Wort Gottes und damit Schöpfungsmittler. Sein Versöhnungswerk hat gemäss Kolosser 1 kosmologische Dimensionen. Jesus-Frömmigkeit und die Freude an der Schöpfung gehören daher untrennbar zusammen», so Stettler.
Durch Forschen zum Glauben
Das erste Referat hielt Dr. Boris Schmidtgall von der Studiengemeinschaft «Wort und Wissen». Durch hartnäckiges Suchen und Fragen ist er als atheistischer Naturwissenschaftler zur Überzeugung gekommen, dass das biblische Zeugnis wahr ist. Als promovierter Chemiker unterzog er im Hauptteil des Referates die gängige Evolutionstheorie einer fundierten Kritik. Selbst viele ungläubige Wissenschaftler betrachten die Evolutionstheorie als unhaltbar. Doch aufgrund der ideologischen Ausrichtung der Wissenschaften dürfe dies nur hinter vogehaltener Hand geäussert werden. Es handle sich daher nicht mehr um Wissenschaft, sondern um Ideologie mit dem Ziel, Gott zu leugnen (vgl. Röm 1,20f.).
Das Buch der Natur
«Die Schöpfung wiedergewinnen – Schritte zu einer reformatorischen Weltsicht»: So lautete der Titel des zweiten Referates von Pfr. Dr. Jürg Buchegger. Die christliche Erlösung ohne die Lehre von der Schöpfung verliert das Wesen des Evangeliums und verkommt zu einer subjektiven Gefühlsreligion ohne Halt in der Wirklichkeit. Gott bezeugt sich in zwei Büchern: im Buch der Schrift und im Buch der Natur. Die Schöpfungs- und Erhaltungsordnungen Gottes müssen daher in der Theologie wieder neu gewichtet werden.
Klimatismus als Utopie
Anregend und kontrovers war das letzte Referat durch Pfr. Willi Honegger mit dem Titel: «Dem Herrn gehört die Erde! Ist der ‹Klimatismus› eine Selbstüberschätzung?» Die Frage beantwortet er mit Ja, denn die Rettung des Klimas sei eine utopische Bewegung, die auf einem falschen Gottes- und Menschenbild fusse: Als ob Gott nicht der Herr wäre, als ob der Mensch aus eigenen Kräften die Welt retten könnte. Der Referent warnte die Kirchen vor einer kritiklosen Übernahme dieser widersprüchlichen ideologischen Grundlagen. Stattdessen solle sie den biblischen Gott bezeugen und ehren.
Die Tagung machte deutlich, dass man sich mit dem Thema «Schöpfung und Vollendung» auf einem gesellschaftlichen Minenfeld bewegt. Umso wichtiger ist es, dazu einen klaren Standpunkt zu finden, der wachsam ist gegenüber ideologischen Fehlentwicklungen.
Gergely Csukás, im März 2024
Tagung am 30. September 2023
Verkündigen - rede und schweige nicht!
Verkündigen - rede und schweige nicht!
Schriftliche Version der VortrÄge
Rodriguez: «Predige das Wort!» (Predigt)
Felber: «Ich hab doch das Neue, wozu brauch ich noch das Alte?» (Vortrag)
Parzany: «Freimut in der Verkündigung» (Vortrag)
Widler: «Den Namen 'Jesus' umschiffen» (Vortrag)
Rede und schweige nicht!
Was wenn die Verkündigung auf Widerstand stösst? Damit beschäftigte sich das Netzwerk Bibel und Bekenntnis Schweiz am 30. September in Aarau.
Predige das Wort!
Die Herbsttagung des Netzwerks im TDS Aarau begann mit einem Gottesdienst, den Pfrn. Dagmar Rohrbach leitete. Pfr. Benjamin Rodriguez predigte über das Vermächtnis des Apostels Paulus im zweiten Brief an Timotheus. Dieser sollte das Wort zur Zeit und zur Unzeit predigen, zurechtweisen und ermahnen, um der gesunden Lehre Nachachtung zu verschaffen, dabei nüchtern und leidensbereit sein (2 Tim 3,14-4,8). Im Zentrum der Verkündigung, so Benjamin Rodriguez, steht Jesus Christus, wie ihn die Bibel und die Bekenntnisse vorstellen. Paulus stellte seinem Schützling den Ernst der Aufgabe vor Augen. Rodriguez paraphrasierte: «Predige das Wort, denn daran entscheidet sich die Ewigkeit für diejenigen, die vor den Richterstuhl Christi treten. Predige das Wort, denn die Zeit drängt, Jesus kommt bald.»
Christus und die Kirche – nicht ohne das Alte Testament
Im ersten Vortrag der Tagung legte Dr. Stefan Felber dar, warum das Alte Testament für die christliche Verkündigung unverzichtbar ist. Die Schriften des Neuen Testaments schliessen an die Bücher des AT an. «Für die Autoren des Neuen Testaments wäre der Gedanke, sich vom Alten Testament zu lösen, absurd erschienen.» Vor König Agrippa betonte Paulus, er sage «nichts, als was die Propheten und Mose gesagt haben, dass es geschehen soll». Felber gliederte die aktuellen Einwände gegen die Gültigkeit des Alten Testaments in fünf Gruppen, die er an konkreten Beispielen darstellte. Er schloss mit darauf antwortenden Thesen, unter ihnen die Warnung: «Wer das Alte Testament aus dem Kanon nimmt oder sich ihm sonst nicht mehr auseinandersetzen will, schafft das Christentum, das Christsein, die ganze Kirche ab.»
Warum verschweigen wir, was zu predigen ist?
Nach der Mittagspause sprach der Theologe und Evangelist Ulrich Parzany, Leiter des deutschen Netzwerks Bibel und Bekenntnis. Die Frage: «Was hindert uns zu reden?» beantwortete er dreifach: (1) Wir möchten Menschen gewinnen und nicht vor den Kopf stossen. (2) Wir arrangieren uns zu fest mit den Rahmenbedingungen, in denen wir Leben. (3) In der polarisierten Gesellschaft würden versöhnliche Botschaften erwartet. Parzany betonte jedoch aufgrund der Berichte im Neuen Testament: «Die Verkündigung des Evangeliums von Jesus spaltet in jedem Fall die Hörerschaft. Von Anfang an.» Der Referent schloss mit der tröstlichen Erfahrung schon der ersten Christen, dass die Bitte um Freimut erhört wird. Scharf wandte sich Ulrich Parzany dagegen, dass Christen in Westeuropa sich als unfrei oder gar verfolgt ansehen: Er führte die Bedrängnis anderer Christen an. Das Schweigen hiesiger Theologen bezeichnete der international bekannte Evangelist als Feigheit. Zu sagen sei das Evangelium allerdings immer mit Liebe: «Ohne Liebe geht nichts… Aus der Liebe, die der Heilige Geist gibt, ringen wir um die angemessene Form: die Wahrheit zu sagen.»
Prediger-Pirouetten
Philipp Widler, Pfarrer am Untersee, rundete die Tagung mit persönlichen Reflexionen zum Verschweigen und Verschleiern ab. Obwohl er das Wort der Bibel unverfälscht predigen wollte, habe er einen Weg hin zu Predigerpirouetten beschritten. Dazu veranlasst habe ihn u. a. das landeskirchliche Mantra ‹Wir müssen für alle da sein – und dürfen niemand abschrecken›. Doch biblische Zentralbegriffe sind wieder und wieder durchzubuchstabieren, sagte Widler. Er wolle bei Abdankungen die christliche Ewigkeitsperspektive darlegen. Das Amt des Verkündigens bleibe ein Kampf. Pfarrer und Pfarrerinnen sollten einander gegenseitig stärken und intensiv an einer unverkürzten Darlegung des Evangeliums arbeiten.
Am Ende der Tagung standen die drei Referenten den 65 Teilnehmenden Red und Antwort. Dabei wies Ulrich Parzany auf die zunehmende Offenheit fürs Evangelium in der islamischen Welt hin. Er sprach von einer riesigen Bewegung hin zu Christus.
Willi Honegger, der durch die Tagung geführt hatte, schloss sie mit Dank und Gebet.
Peter Schmid, im Oktober 2023
Tagung am 18. März 2023
Die Verkündigung: Gute Nachricht - unbequeme Botschaft
Die Verkündigung: Gute Nachricht - unbequeme Botschaft
Schriftliche Version der Vorträge (teilw. Stichpunkte)
Honegger: «Wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes!» (Predigt)
Hertig: «Der Verkündiger: Aus der Sicht eines Zuhörers»
Buchegger: «Der Gottesdienst der Gemeinde – mehr als ein Event»
Welche Verkündigung tut Not?
Einen ausführlicheren Rückblick finden Sie hier (lkf.ch).
Das Netzwerk Bibel und Bekenntnis Schweiz suchte am 18. März in Winterthur die Antwort in der Spannung zwischen Guter Nachricht und unbequemer Botschaft.
Die Vorträge der Tagung kreisten um das Potenzial der biblischen Verkündigung. Willi Honegger, Pfarrer in Bauma, predigte über die scharfen Worte Jesu in Johannes 8,37-47. Auch heute gebe es einen «heftigen Erbstreit»: Der Zeitgeist wolle die christliche Tradition beerben. In dieser Situation, so Honegger, wirkt das Wort Jesu entlarvend; das Böse wird offengelegt. «Nur wer die Wahrheit über den Menschen ausspricht, kann vollmächtig die Grösse der Gnade Gottes verkündigen!» Jesus biete weder Optimierung noch Coaching, sondern Rettung. Der Verkündiger habe darum zu ringen, dass Jesu Stimme gehört wird – nicht um den Erhalt kirchlicher Strukturen. Die biblische Gesamtsicht der Wirklichkeit sei dem säkularen Weltbild gegenüberzustellen, sagte Honegger und forderte einen entschlossenen «apostolischen Zeugendienst».
«Seid anders, seid mutig!»
Der Unternehmer Ruedi Hertig, Tann, bot eine Hörerperspektive. Er ermutigte die Verkündiger, angesichts des kirchlichen Niedergangs ihrer ursprünglichen Berufung treu zu bleiben: «Seid anders, seid mutig!» In manchen Freikirchen sieht Ruedi Hertig die Pastoren unter grossem Erfolgsdruck. Vieles habe man in den letzten Jahrzehnten versucht, um Gemeinde attraktiv und relevant zu machen; insgesamt sei die biblische Lehre vernachlässigt worden. Hertig machte Mut, in kleinen Gemeinden treu am Wort zu dienen.
«Wir sind nicht unter uns»
Nach der Mittagspause profilierte Jürg Buchegger, pensionierter Frauenfelder Pfarrer, den evangelischen Gottesdienst gegenüber Events. «Wir feiern Gottesdienst unter dem offenen Himmel, wo der ewige Gottesdienst gefeiert wird.» Mit Bemerkungen zu Hebräer 12,18-25 kritisierte Buchegger, dass Performance und Inszenierung vorrangig werden. Im Gottesdienst strecken sich die Gläubigen aus nach der Wiederkunft des Herrn. Gott wirkt Glauben durch Verkündigung, hob Buchegger hervor – das Wort «wird von aussen an uns herangetragen; wir tragen es nicht schon immer in uns». Dabei müsse der Gottesdienst keineswegs eine Soloveranstaltung des Pfarrers mit alten Liedern sein.
Den ganzen Christus verkündigen
Gegen die Meinung, klare Lehre und «Dogmen» stünden christlicher Einheit im Weg, wandte sich der Neutestamentler Christian Stettler, Pfarrer in Flaach, im abschliessenden Vortrag. Es gilt vielmehr, den ganzen Christus zu verkündigen. Ohne Lehre geht das nicht. «Wir können Jesus nicht kennen ohne die Lehre über ihn, welche die Apostel in Jerusalem weitergegeben haben.» Stettler rief dazu auf, um ein ganzheitliches Bild von Jesus Christus zu ringen. «Wir alle stehen in der Gefahr, unseren eigenen Jesus zu basteln. Er ist immer viel grösser ist als unser Verständnis von ihm.»
Peter Schmid, im März 2023 (zuerst erschienen im IDEA 12.2023)
Tagung am 2. Juli 2022
Bibel und Bekenntnisse – Die Grundlagen
Bibel und Bekenntnisse – Die Grundlagen
Die Tagung am 2. Juli 2022 begann mit einem Abendmahlsgottesdienst. Aus dem Gottesdienst, dem Hören auf Gottes Wort und dem Empfang des Abendmahls wächst Stärkung und Klarheit. Den Gottesdienst leiteten Pfarrer Lukas Zünd und Pfarrerin Sabine Aschmann. 50 Personen haben sich an diesem Tag im Kirchgemeindehaus Winterthur Seen zur 2. Tagung des Netzwerks Bibel und Bekenntnis Schweiz versammelt.
In ihrem Referat ging die Theologin und Pfarrerin Hanna Stettler auf die Frage ein: «Handelt Gott in der Geschichte?». Das beantworten die meisten Christen mit «Ja», denn sonst würden sie ja nicht beten. Auch das Beten des Unser Vater setzt diese Überzeugung voraus, obwohl es seit 250 Jahren von der Theologie problematisiert wird. Im Versuch, den christlichen Glauben angesichts wissenschaftlicher Entwicklungen zu «retten», begann man besonders im 20. Jahrhundert, die Wunder als Legenden zu verstehen, mit denen die Gemeinde Jesus als Gottes Sohn verkündigte. Auch die überlieferte Verkündigung Jesu soll zum grössten Teil auf die nachösterliche Gemeindebildung zurückgehen. Man könne aber nicht mehr wissen, was Jesus wirklich gesagt habe. Dieser Geschichtspessimismus führte dazu, dass viele Theologen alles Gewicht auf die Predigt, das sog. «Kerygma» legten: In der Verkündigung könne der Mensch vom «Wort» erreicht werden und zu seiner eigentlichen Existenz finden. Dazu sei die historische Verlässlichkeit der Inhalte aber keine notwendige Voraussetzung.
Diesen Überzeugungen stellte Hanna Stettler «Die Rückkehr der Augenzeugen» entgegen. Insbesondere die neueren Forschungen von Richard Bauckham, Martin Hengel und anderen zeigen plausibel, dass die altkirchlichen Überlieferungen wahr sind, und dass wir es bei den Evangelisten mit Augenzeugen zu tun haben, die bezeugen, was sie gehört und gesehen haben.
Im zweiten Referat widmete sich der Kirchengeschichtler Sven Grosse dem Thema: «Die zertrümmerte Bibel – wie es dazu kam.» Er stellte mit Johann Philipp Gabler einen Vertreter der Theologie der Aufklärung vor. In seiner Antrittsrede (1787) als Professor beschrieb Gabler die biblische Theologie als eine von der Dogmatik (Glaubenslehre) unabhängige Wissenschaftsdisziplin. Die Biblische Theologie ist für ihn eine historisch orientierte Wissenschaft, die die allgemeinen Vorstellungen der Bibel von ihren zeitbedingten Einkleidungen abhebt: Es gehe der Theologie darum, die Gedanken der Schriftsteller nachzuzeichnen, die in erster Linie an die Menschen ihrer Zeit gerichtet waren. Die Dogmatik (Glaubenslehre) dagegen müsse die Vorstellungen jener Zeit in die aktuellen Vorstellungen der modernen Zeit übersetzen. Dabei schied für Gabler das Alte Testament als mindere Schrift vom Neuen Testament. Insgesamt versuchte er – wie andere Zeitgenossen – zwischen der äusseren Gestalt der biblischen Überlieferung und ihrem Kern zu unterscheiden. Auch hier wird das Bibelwort auf religiöse Vorstellungen und Ideen der Propheten und Evangelisten reduziert, die für heutige Zeiten neu interpretiert werden müssen. Damit versprach er sich auch die Lösung der Differenzen zwischen unterschiedlichen christlichen Konfessionen in der Glaubenslehre.
Sven Grosse stellt Gablers Ansatz einen konstruktiven Gegenentwurf entgegen: Er plädiert dafür das Selbstzeugnis der Schrift ernst zu nehmen, was die Bibel zusammenhält. Nach Jesu eigenen Worten (z. B. Joh 5,39.46) ist er der Inhalt der Schrift. Darum sagte Martin Luther: «Nimm Christus aus den Schriften, was willst du sonst weiter in ihnen finden.» Wenn die christlichen Konfessionen darin übereinstimmen, dass die Bibel durchgehend von Christus, bzw. dem dreieinigen Gott spricht, dann hat man bereits einen grossen Konsensus. Dieser Konsensus zeigt, dass man sich doch bereits in den Grundlagen einig ist. Die bleibenden Differenzen in der Glaubenslehre könne man dann im geduldigen Gespräch diskutieren, im Wissen, dass man einen grossen gemeinsamen Boden hat.
Im dritten Referat geht Pfarrer Willi Honegger auf das Apostolische Glaubensbekenntnis ein, das für die Kirche und ihren Glauben unverzichtbar ist: Es ist Kern und Schlüssel für die Botschaft der ganzen Bibel, eine regula fidei (Glaubensregel) für die Auslegung der Bibel. Es lehrt uns den roten Faden der Heilsgeschichte von der Schöpfung bis zu Vollendung. Es ist wie andere altkirchliche Glaubensbekenntnisse aus grossen theologischen Kämpfen entstanden. Es diente zur Abwehr gegen verschiedene Irrlehren. Darum ist das Apostolische Glaubensbekenntnis zusammen mit anderen Bekenntnissen auch bis heute aktuell, weil auch heutige Irrlehren den alten gleichen. In diesem Sinn ist das Apostolikum auch prophetisch: Bis heute eine eiserne Ration im geistlichen Kampf.
Alle drei Referate können nachgehört werden auf der Webseite oder dem dazugehörigen Youtube-Kanal.
Jürg Buchegger, im Juli 2022
Gründungstagung am 30. Oktober 2021
Bei herrlichem Herbstwetter fand am 23. Oktober 2021 in Winterthur-Seen die Gründungstagung des Netzwerks «Bibel und Bekenntnis» statt. Etwa 80 Personen waren zugegen und nahmen (auf mehrere Räume) verteilt am ganztägigen Programm teil. Der Reigen der Vorträge begann mit einem Grusswort des deutschen Evangelisten Ulrich Parzany. Im anschliessenden Gottesdienst stand die Predigt von Willi Honegger unter einem Wort des Propheten Jeremia: «Das Wort des HERRN haben sie verachtet. Und welche Weisheit ist ihnen geblieben?» (Jeremia 8,9)
Nach dem Mittagessen standen 3 Referate auf dem Programm: Prof. Benjamin Kilchör sprach zu: «‚Gott ist die Liebe‘ – oder: ‚Die Liebe ist Gott‘?», Pfr. Philipp Widler zur «Bekennenden Nachfolge» und Prof. Christian Stettler zu: «Warum die Sprache Kanaans unverzichtbar ist». Alle Vorträge und Ansprachen werden bald auf der Internetseite bibelundbekenntnis.ch als Video aufgeschaltet sein.
Die Tagung bekräftigte den Willen, durch das Festhalten an der Heiligen Schrift auf eine Erneuerung von Kirche und Theologie hinzuarbeiten. Die unzähligen Versuche in den letzten 50 Jahren, die Kirche in anderer Art zu erneuern, erachten wir als weitgehend gescheitert. Das Netzwerk hat die Absicht, in Zukunft 1-2 Tagungen pro Jahr zu veranstalten, um diese Vision zu vertiefen. Nun gilt es, Freunde und Engagierte für das Netzwerk zu gewinnen. Auf der Internetseite kann man sich schon jetzt dafür eintragen.
Der bisherige ad-hoc-Arbeitskreis wird bald in eine feste Vorbereitungsgruppe überführt. Ihr obliegt es dann, die Kommunikation nach aussen und die Planung weiterer Aktivitäten in die Hand zu nehmen.
W. Honegger, 28.10.2021